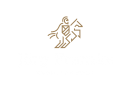RESTRUKTURIERUNGS-VERFAHREN = SANIERUNG OHNE INSOLVENZ
Mit dem Restrukturierungsverfahren nach dem neuen StaRUG-Gesetz gibt es nun ein Instrument, das Unternehmen dabei unterstützt, sich erfolgreich zu restrukturieren und somit eine drohende Insolvenz abzuwenden. Nutzen Sie diese Chance für Ihr Unternehmen!

Insolvenz abwenden mit dem Restrkturierungsverfahren
Restrukturierung gegen drohende Insolvenz.
Sie suchen nach einer Lösung, um Ihr Unternehmen wieder auf den richtigen Kurs zu bringen?
Dann sollten Sie sich das Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG genauer anschauen. Dieses innovative Gesetz zur vorinsolvenzlichen Sanierung von Unternehmen bietet einen zeitgemäßen Ansatz, um die Finanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Mit dem Restrukturierungsverfahren haben Sie die Möglichkeit, eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und Ihr Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie das StaRUG-Verfahren dabei helfen kann.
Kontaktieren Sie mich jetzt und lassen Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten der Restrukturierung nach dem StaRUG für Ihr Unternehmen besprechen.
Durch das Restrukturierungsverfahren hat der Gesetzgeber einen neuen rechtlichen Rahmen geschaffen, der es Unternehmen ermöglicht, einen Restrukturierungsplan mit einzelnen Gläubigern auszuhandeln und diesen auch gegen den Widerstand bestimmter Gläubiger mithilfe des Gerichts durchzusetzen. Sollte es jedoch zu Widerständen kommen, ist es erforderlich, das Restrukturierungsverfahren bei Gericht anzumelden. In diesem Fall wird ein Restrukturierungsbeauftragter ernannt, der die Positionen der Gläubiger schützt, die grundrechtlich geschützt sind.
Tipp 1: Die Vorteile des Restrukturierungsverfahrens für Unternehmen
Der Restrukturierungsrahmen nach StaRUG (Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts) bietet Unternehmen in Deutschland eine Reihe von Vorteilen bei drohender Insolvenz. Einige dieser Vorteile sind:

Schutz vor Insolvenzverfahren
Unternehmen können das Restrukturierungsverfahren nutzen, um Insolvenzverfahren abzuwenden.

Sanierung durch Eigenverwaltung
Die Geschäftsführung behält die Kontrolle über die Sanierung in Eigenverwaltung und ist nicht auf Insolvenzverwalter angewiesen.

Flexibilität
Die Restrukturierung bietet Flexibilität bei der Ausgestaltung des Sanierungskonzepts und der Durchführung der Maßnahmen.

Chance auf Fortführung
Eine erfolgreiche Restrukturierung kann dazu führen, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich fortgeführt werden kann und Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Erhaltung des Unternehmens
Der Restrukturierungsrahmen soll helfen, das Unternehmen zu erhalten und den Fortbestand zu sichern.

Schutz vor Gläubigerforderungen
Der Restrukturierungsplan ermöglicht es dem Unternehmer, die Forderungen seiner Gläubiger zu begrenzen und zu kürzen.

verhandlungsposition
Eine erfolgreiche Restrukturierung verbessert die Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten, Kunden, Geschäftspartnern.

Vermeidung von Insolvenz
Durch eine erfolgreiche Restrukturierung kann das Unternehmen einer drohenden Insolvenz entgehen und daher die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Mitarbeiter, Gläubiger und Geschäftspartner vermeiden.
Tipp 2: Das Restrukturierungsverfahren ist kein Insolvenzverfahren
- Das Restrukturierungsverfahren ist KEIN Insolvenzverfahren. Im Unterschied zur Insolvenz darf die Geschäftsführung eigenständig zu entscheiden, welche Schulden man reduziert und welche man aus Gründen der Geschäftskontinuität unberührt lässt. Beispielsweise wird man Forderungen von Lieferanten von der Kürzung ausnehmen, um die Versorgung des Unternehmens nicht zu gefährden.
- Der angenehme Nebeneffekt der gezielten Auswahl der planbetroffenen Gläubiger, die gekürzt werden sollen, besteht darin, dass niemand außer den betroffenen Gläubigern von der Restrukturierung erfährt. Das Verfahren ist nicht öffentlich. Es wird diskret durchgeführt und ist vertraulich. Dies ist ein wichtiger Faktor, um das Vertrauen der Geschäftspartner und Kunden aufrechtzuerhalten.
- Doch nicht nur für den Betrieb selbst hat die gezielte Auswahl der planbetroffenen Gläubiger Vorteile. Auch für die betroffenen Gläubiger kann es positiv sein, wenn sie bewusst ausgewählt werden. Denn damit besteht noch eine Chance, dass ihre Forderungen teilweise bedient werden können. In der Insolvenz würden sie vollständig ausfallen.
Tipp 3: Mit Restrukturierung möglichst früh starten
- Für eine erfolgreiche Sanierung eines Unternehmens mit dem Restrukturierungsverfahrens bedarf es einerseits einer Krise, andererseits darf die Zahlungsunfähigkeit noch nicht eingetreten sein. Das bedeutet: Die vorinsolvenzliche Sanierung nach dem StaRUG ist nur bei drohender Zahlungsunfähigkeit anwendbar. Bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist die Insolvenz in Eigenverwaltung besser.
-
Es ist von großer Bedeutung, stets nachzuweisen, dass im Zuge des Restrukturierungsprozesses weder eine Zahlungsunfähigkeit noch eine Überschuldung aufgetreten ist. Dieser fortlaufende Nachweis ist unerlässlich. Denn nur so kann das Unternehmen von den Vorteilen des StaRUG profitieren und eine erfolgreiche Sanierung durchführen.
-
Allerdings sollte man sich als Betroffener bewusst sein: Eine vorinsolvenzliche Sanierung ist kein Selbstläufer und erfordert viel Arbeit sowie einen klugen Plan zur Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. Doch wer diesen Weg geht, kann am Ende gestärkt aus der Krise hervorgehen – mit einem zukunftsfähigen Geschäftskonzept und neuen Perspektiven für alle Beteiligten!
Tipp 4: So unterscheiden sich Restrukturierung, Eigenverwaltung und Schutzschirm
- Die Insolvenz und die Restrukturierung haben beide das Ziel, eine finanzielle Krise zu bewältigen. Die Verfahren unterscheiden sich in ihrem Ansatz und den Konsequenzen. Das Insolvenzverfahren ist der letzte Ausweg, wenn ein Schuldner alle seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Die Restrukturierung ist richtig, wenn der Schuldner die Sculden teilweise nicht mehr bezahlen kann.
-
Im Gegensatz dazu zielt die Restrukturierung darauf ab, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, indem es von ihm ausgewählte Schulden neu strukturiert. Das Ziel der Restrukturierung ist es, den Betrieb wieder wettbewerbsfähig und bestandsfähig zu machen und eine Insolvenz aufgrund Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden.
Tipp 5: So ist der Ablauf eines Restrukturierungsverfahrens
Ein Restrukturierungsverfahren kann unterschiedliche Schritte und Maßnahmen umfassen, die davon abhängen, welche Probleme zu bewältigen sind. Das Verfahren gibt Firmen mit Liquiditätsengpässen eine sehr gute Möglichkeit, auf die betriebliche Krise zu reagieren. Im Allgemeinen sieht ein Restrukturierungsverfahren folgende Schritte vor:

Analyse der aktuellen Situation und Identifizierung der Probleme und Ursachen: Im ersten Schritt wird die aktuelle Situation des Unternehmens genau untersucht und analysiert. Dabei sollen die Hauptprobleme und Ursachen für die Schwierigkeiten ermittelt werden, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Planung und Entwicklung einer Restrukturierungsstrategie: Basierend auf der Analyse werden geeignete Maßnahmen entwickelt und ein Plan für die Umsetzung erarbeitet. Diesen Plan nennt man Restrukturierungsplan und ist eine Mischung aus Insolvenzplan und Businessplan. Die Maßnahmen können dabei sowohl operative als auch finanzielle Aspekte und organisatorische Änderungen beinhalten.

Verhandlungen mit Gläubigern: Wenn eine finanzielle Restrukturierung notwendig ist, müssen Verhandlungen mit Gläubigern geführt werden, um Schulden zu restrukturieren oder Zahlungen zu stunden. In jedem Verfahren gibt es Gläubiger, die einer Kürzung ihrer Forderungen zustimmen würden und Gegner. Diese Gläubigerstruktur gilt es zu ermitteln, um damit sinnvolle Gruppen für die Abstimmung über den Restrukturierungsplan zu bilden.

Umsetzung der Maßnahmen: Wenn die Planung abgeschlossen ist und alle Stellungnahmen der planbetroffenen Gläubiger vorliegen, können die Maßnahmen des Restrukturierungsplans umgesetzt werden. Der nächste Schritt ist damit die Abstimmung der Maßnahmen mit dem Restrukturierungsbeauftragten und dem Gericht.

Abstimmungstermin bei Gericht: Am Schluss des Restrukturierungsverfahrens wird des einen Verhandlungstermin bei Gericht geben, in dem die Gläubiger über die Maßnahmen abstimmen. Aufgrund geschickter Einteilung der Gläubiger in Gruppen gilt die Zustimmung als sicher. Die Gerichte nehmen nur aussichtsreiche Pläne an.
Tipp 6: Die Zeitplanung und Kosten der Restrukturierung
-
Das Restrukturierungsverfahren für Unternehmen dauert ungefähr sechs Monate und lässt sich in folgende Phasen einteilen:
-
Vorbereitung 2 – 8 Wochen: Hier werden die Maßnahmen geplant und der Restrukturierungsplan ausgearbeitet
-
Abstimmung mit dem Restrukturierungsbeauftragten 2 – 6 Wochen: Diesem wird der Restrukturierungsplan vorgelegt und er überprüft ihm im Auftrag des Gerichts auf rechtliche Mängel, die behoben werden.
-
Abstimmung mit dem Gericht 2 – 4 Wochen: Der abgestimmte Restrukturierungsplan wird dem Richter vorgelegt. Dieser überprüft den Plan ebenfalls auf Mängel. Ist der Plan okay, bestimmt das Gericht den Abstimmungstermin.
-
Vorbereitung des Abstimmungstermins 2 – 4 Wochen: Hier sind insbesondere Vollmachten der zusstimmenden Gläubiger einzuholen.
Die Kosten für eine Restrukturierung variieren je nach Umfang und Dauer des Verfahrens. Regelmäßig fallen folgende Gebühren an:
- Honorar für den Berater, der das Verfahren leitet und überwacht
- Kosten für den Restrukturierungsbeauftragten,
- der die Sanierungsmöglichkeiten bewertet
- Gerichtskosten für das Verfahren
- Quote zur Abfindung der Gläubiger
Das Honorar für Ihren Berater handeln Sie frei mit ihm aus. Die Kosten für den Restrukturierungsbeauftragten bestimmt das Gericht und berechnet sich nach dem Zeitaufwand. Sein Stundensatz darf maximal 350 € betragen. Die Gerichtskosten sind als Vorschuss zu leisten, nachdem die Restrukturierung beim Gericht angezeigt wurde.
Mehr Infos zur Restrukturierung
Weitere Informationen zum Restrukturierungsverfahren von Unternehmen und erfolgreiche Fallbeispiele aus meiner täglichen Beratungspraxis finden Sie hier.
Tipp 7: Pro und Contra Insolvenz oder Restrukturierungsverfahren
Pro Restrukturierungsplan:
- Das Unternehmen kann weiterhin eigenständig agieren und bleibt unter der Kontrolle des Managements.
- Es besteht die Möglichkeit, den Schuldenschnitt auf einzelne Gläubiger zu begrenzen, etwa auf eine Bank. Andere Gläubiger lässt man unangetastet.
- Auch die Gesellschafterstruktur lässt sich mit dem Restrukturierungsverfahren neu ordnen, etwa durch Ausschluss einzelner sanierungsfeindlicher Gesellschafter.
- Der Geschäftsbetrieb wird ohne jede Beeinträchtigung fortgeführt.
- Die Reputation des Unternehmens wird geschützt, da es nicht öffentlich als insolvent dargestellt wird.
- Regressansprüche gegen die Geschäftsführung werden im Gegensatz zum Insolvenzverfahren nicht geprüft.
- Das Restrukturierungsverfahren wird bei guter Vorbereitung nicht länger als drei Monate dauern.
Contra Restrukturierungsplan:
- Die Mitarbeiter erhaltenen kein Insolvenzgeld, so wie im Schutzschirmverfahren oder in der Eigenverantwortung. Das Unternehmen muss alle Kosten des Restrukturierungsverfahrens selbst tragen.
- Das Unternehmen darf bei der Antragstellung nicht zahlungsfähig oder überschuldet (=insolvenzreif) sein.
- Tritt die Insolvenzreife während des Restrukturierungsverfahrens ein, wird es abgebrochen. Ausnahme: die Insolvenzreife tritt aufgrund der Fälligstellung einer Forderung ein, die gekürzt werden soll.
- Man darf im Restrukturierungsverfahren nur Geldforderungen kürzen. Bestehende Verträge wie Mietvertrag, Arbeitsvertrag oder Factoring bleiben unangetastet.
- Es besteht kein Sonderkündigungsrecht, so wie im Schutzschirm oder in der Eigenverwaltung.
Pro Insolvenz in Eigenverwaltung:
- Die Eigenverwaltung ist auch nach Überschreiten der Insolvenzreife noch zulässig.
- In der Insolvenz in Eigenverwaltung kann das Unternehmen zügig neue Liquidität aufbauen, indem es radikal die Zahlungen an Altgläubiger einstellt. Zusätzlich zahlt der Staat drei Nettolöhne an die Mitarbeiter als Insolvenzgeld.
- Die Insolvenz in Eigenverwaltung berechtigt das Management zur fristlosen Kündigung von Verträgen jeder Art. Ausnahme: Mietverträge über Immobilien und Arbeitsverträge sind nach drei Monaten kündbar.
- Das Unternehmen lässt sich von Grund auf neu strukturieren. Filialen können etwa kostenneutral abgestoßen werden.
Contra Insolvenz in Eigenverwaltung:
- Die Reputation des Unternehmens leidet, da es öffentlich als insolvent dargestellt wird.
- Die Eigeninsolvenz unterliegt der Überwachung eines gerichtlich bestellten Sachwalters. Er darf sich zwar nicht einmischen, wird den Sanierungsprozess jedoch akribisch kontrollieren und steht der Eigenverantwortung oft kritisch gegenüber.
- In der Insolvenz in Eigenverwaltung besteht die gesetzliche Pflicht, das Unternehmen (=die Insolvenzmasse) bestmöglich zu verwerten. Das bedeutet, dass das Management parallel zu den Sanierungsmaßnahmen einen Käufer oder Investor für das Unternehmen suchen muss. Nur falls sich kein Käufer finden lässt, wird es mit dem Insolvenzplan entschuldet und bleibt den Altgesellschaftern überlassen.
- Die Kosten für den Sachwalter sind sehr hoch und können eine Hürde für den Erfolg der Sanierung sein.
Kostenfreie Experten-Einschätzung zu den Sanierungsaussichten Ihres Unternehmens
- Schutzschirmverfahren?
- Insolvenz in Eigenverwaltung?
- Restrukturierungsverfahren?
- Regelinsolvenz?
- Auffanggesellschaft?
Machen Sie den Schutzschirm-Check: Wie können Sie Ihr Unternehmen bestmöglich sanieren? Hier ist ein kostenfreier Test.
Ermitteln Sie mit meiner Hilfe das bestmögliche Verfahren. Geben Sie unten die Daten Ihres Unternehmens ein und Sie erhalten von mir eine kostenfreie Einschätzung, welches Sanierungsverfahren für Ihr Unternehmen das Beste ist. Beratung vom Profi, Erfahrung aus tausenden Verfahren.
Ich respektiere den Datenschutz und verwende Ihre Daten ausschließlich, um Ihnen zu antworten.

Jörg Franzke
Rechtsanwalt
Als sehr erfahrener Sanierungsprofi und Anwalt für Insolvenzrecht führe ich Ihr Unternehmen aus den Schulden. Erfahrung aus rund 135 Sanierungsverfahren.
Es handelt sich um eine sehr schwierige Materie. Anstatt lange zu lesen, schlage ich vor, dass Sie das Formular ausfüllen. Danach erhalten Sie von mir eine kostenlose Einschätzung, wie Sie Ihre Firma am besten sanieren. Auf Wunsch können wir danach kurz unverbindlich telefonieren. Eine kurze Expertenberatung bringt Ihnen mehr, als stundenlanges Lesen.